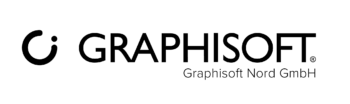Wohnen wird unbezahlbar
Was kann die Planung dagegen tun?
Wohnen ist zur sozialen Frage unserer Zeit geworden. In Großstädten reißt der Quadratmeterpreis selbst für Altbauwohnungen in mittelguten Lagen inzwischen jedes Budget. Auch im Umland steigen die Mieten. Die Mittelschicht wandert ab, Geringverdienende werden verdrängt, selbst Normalverdiener kämpfen um bezahlbare vier Wände. Die Ursachen sind vielfältig: zu wenig Neubau, Spekulation mit Boden, teure Baustandards, hohe Zinsen. Doch der Kern des Problems liegt oft in der Planung selbst.

Fehlentwicklungen in der Planung
Die kommunale Planung hinkt der Realität hinterher. Jahrzehntelang wurde vor allem für das Auto geplant: Siedlungen auf der grünen Wiese, Einkaufszentren am Stadtrand, Einfamilienhausgebiete ohne soziale Infrastruktur. Diese Zersiedelung frisst Fläche, schafft Abhängigkeit vom Auto und verhindert dichte, gemischte Quartiere, in denen Menschen aller Einkommen leben könnten.
Gleichzeitig scheuen viele Planungsämter die Verdichtung im Bestand. Statt vorhandene Potenziale zu heben, bleiben Baulücken und Leerstände ungenutzt.

Flächenpolitik als sozialpolitisches Instrument
Die wichtigste Ressource für Wohnraum ist nicht Beton, sondern Boden. Wer ihn besitzt, bestimmt, was gebaut wird. Und zu welchem Preis. Kommunen, die Boden bevorraten und strategisch einsetzen, können die Richtung vorgeben: sozial, nachhaltig, bezahlbar. Doch vielerorts wurde öffentlicher Grund verkauft – oft an den Meistbietenden. Das war ein Fehler. Wer heute Wohnungsnot lindern will, muss Bodenpolitik als Teil der Sozialpolitik verstehen. Das heißt: Grundstücke nicht mehr einfach veräußern, sondern langfristig in kommunaler Hand halten.
Neue Werkzeuge liegen auf dem Tisch. Baugemeinschaften zum Beispiel bauen meist günstiger, nachhaltiger und sozial durchmischt. Sie brauchen allerdings Unterstützung und Planungssicherheit. Konzeptvergaben bieten die Chance, städtebauliche, soziale und ökologische Ziele über den Preis zu stellen. Wer ein gutes Nutzungskonzept vorlegt, kommt zum Zug – nicht der mit dem dicksten Portemonnaie. Auch das Erbbaurecht erlebt eine Renaissance: Statt zu verkaufen, vergeben viele Kommunen Grundstücke auf Zeit. Das entzieht Fläche dauerhaft der Spekulation und stabilisiert Mieten.
Kommunale Handlungsmöglichkeiten
Stadtplanung ist keine Bundesangelegenheit. Es sind die Kommunen, die Bebauungspläne aufstellen, Baugebiete ausweisen, Flächen vergeben. Hier liegt auch der Hebel. Wer bezahlbares Wohnen will, muss lokal steuern: durch Bodenbevorratung, durch aktive Liegenschaftspolitik, durch kooperative Verfahren mit Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und Initiativen. Dazu gehört Mut zur Dichte, zum sozialen Mix, zur Teilhabe. Und das Selbstbewusstsein, den Boden nicht mehr zu verscherbeln, sondern für die Allgemeinheit zu nutzen.
Wohnpolitik beginnt im Stadtplanungsamt
Bezahlbarer Wohnraum fällt nicht vom Himmel. Er entsteht dort, wo kommunale Planung nicht nur Flächen verwaltet, sondern Zukunft gestaltet. Die Bodenpolitik ist das Schlüsselinstrument. Wer Boden in öffentlicher Hand hält, kann entscheiden, für wen und wie gebaut wird. Planung muss endlich als Teil der sozialen Infrastruktur begriffen werden. Denn ob eine Stadt lebenswert bleibt, entscheidet sich nicht am Immobilienmarkt – sondern im Stadtplanungsamt.